TKKG - Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine
 D 2006
D 2006++1/2
TKKG – vier Buchstaben, vier Helden so mancher Kindheit. Besonders die Hörspiele nach den Geschichten von Stefan Wolf waren neben „Die Drei ???“ für viele der heutigen Mitzwanziger bis Anfangdreißiger der Einstieg in die Welt des Abenteuers, des Krimis und zugleich der Abschied von Benjamin Blümchen und Löwenzahn. Die auf Wolfs Erzählungen basierende TV-Serie mit Fabian Harloff in der Rolle des Draufgängers und Gaby-Beschützers Tim erfreute sich einer generationenübergreifenden Fangemeinde. Skepsis war also angebracht, als Tomy Wigands („Das fliegende Klassenzimmer“) Pläne, nach einem Drehbuch von Marco Petry ein TKKG-Revival auf der großen Leinwand realisieren zu wollen, bekannt wurden. „TKKG – Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine“ lässt bereits im Titel erahnen, dass wir uns nicht mehr in den farbenfrohen diskussionfreudigen 80ern, sondern im digitalen Zeitalter von iPod, Weblogs und Computer-Würmern befinden.
Kevin (Hauke Diekamp), ein seltsam verwirrter Nachwuchswissenschaftler, der seine beim Wettbewerb „Jugend forscht“ ausgezeichnete Erfindung vorstellen soll, ist der Ausgangspunkt des neuesten Arbenteuers mit Tim (Jannis Niewöhner), Karl (Jonathan Dümcke), Klößchen (Lukas Eichhammer) und Gaby (Svea Bein). Die „Mind Machine“, so ihr Schöpfer, schafft es, die Gehirnaktivitäten auch nur durchschnittlich begabter Schüler so zu stimulieren, dass Lernen und komplizierte Denkaufgaben keine Mühen mehr kosten. Doch mit Kevin stimmt etwas nicht. Verängstigt verlässt er die Bühne des Schulauditoriums. Nur kurze Zeit später verschwindet schließlich unter mysteriösen Umständen seine Freundin Nadine (Anna Hausburg). Die Viererbande beschließt bei Kevin vorbeizusehen, der nach dem Tod seiner Eltern alleine in einem völlig verwahrlosten Haus lebt. Vielleicht hat sein Verhalten auch etwas mit dem Verschwinden von drei anderen Kindern zu tun.
Die Transformation über zwei Jahrzehnte, das ist die wichtigste Botschaft, ist dem Duo Perty/Wigand durchaus gelungen. Ihre vier jugendlichen Protagonisten haben sich den Charme der alten Besetzung auf ihre ganz eigene Art bewahrt, ohne dabei den Fehler zu begehen, Harloff & Co. womöglich kopieren zu wollen. Diese „andere“ TKKG hebt sich deutlich ab von dem obercoolen Posing der „Wilden Kerle“ oder sonstiger Kinderformate, die das richtige Outfit ihrer Jungdarsteller vor einer gehaltvollen Geschichte stellen. Jannis Niewöhner und Svea Bein alias Tim und Gaby, das versteckte TKKG-Liebespärchen, fallen in einem insgesamt spielfreudigen Ensemble aus etablierten (Jürgen Vogel, Ulrich Noethen) und jungen Schauspielern besonders positiv auf. Niewöhner besitzt die richtige Balance aus Cleverness, physischem Drang und Nahdenklichkeit, bei Svea Bein beeindruckt ihre ambivalente Darstellung. Zunächst empfindet man diese Gaby eher als nervende Besserwisserin, später dann ist sie eine uneingeschränkte Sympathieträgerin, mit der sich auch Mädchen in ihrem Alter wunderbar identifzieren können. Gut möglich, dass TKKG in dieser Besetzung noch mehrmals zusammen kommen.
Identifikation mit dem, was man als Heranwachsender liest und sieht, ist oftmals ohnehin der Schlüssel, über den eine Jugendserie ihre zumeist treue Anhängerschaft gewinnt. So auch bei TKKG. Stefan Wolf in der Vorlage und auch Marco Petry im Kinofilm spielen mit den unterschiedlichen Charakteren der Gruppe, die vom sportlichen Mädchenschwarm über den etwas verschrobenen Klassenstreber bis hin zum gemütlichen Kumpeltyp das ganze Spektrum pubertärer Entwicklungen und Wirrungen vereint. Nüchtern betrachtet sind das aller mehr oder weniger schablonenhaften Stereotypen, die sich über wenige Eigenarten definieren lassen. Für Kinder in diesem Alter ist das sekundär, viel wichtiger ist für sie, ob ein Film sie und ihre Gefühlswelt ernst nimmt. Und das tut TKKG zweifellos.
Es mag dem anachronistischen TKKG-Gefühl eines Liebhabers der „alten“ Serie geschuldet sein, aber der eigentliche Plot und das Rätsel um die geheimnisvolle „Mind-Machine“ blieben für mich hinter den Leistungen der jugendlichen Schauspieler merklich zurück. Zu technokratisch, zu wenig Abenteuer-Flair, dazu moderner Krimskrams wie eine überflüssige Talkshow-Parodie und deplazierte Animationseinschübe, darunter leidet die 2006er-Version. Das unterirdische geheime Forschungslabor taugt vermutlich als billige Behausung eines James Bond-Bösewichts, der bei TKKG auch stets präsente Entdeckergeist beschränkt sich in einem solchen Umfeld jedoch auf das Finden des richtigen Ausgangs. Da ist die kurze Stippvisite in Kevins heruntergekommenen Haus um einiges stimmungsvoller geraten. Die besonders für Jugendliche interessanten Aspekte des Falls, Fragen nach den Auswüchsen eines falsch verstandenen Leistungsdrucks in einer Wissensgesellschaft wie der unseren, was es heißt, sich nur noch über das Lernen zu definieren, werden schlussendlich in einem emotionslosen und sich erschreckend nach einer lästigen Pflichterfüllung anfühlenden Showdown nicht konsequent weiter verfolgt. Für den nächsten TKKG-Film würde man sich wünschen, dass die Verantwortlichen bei Gabys Schulprojekt unter dem Slogan „Zurück zur Natur!“ genau zuhören. Credo: Mehr Marshmallow-Grillen am heimeligen Lagerfeuer statt angsteinflößende weil allzu reale Reinhold Beckmann-Doubles!







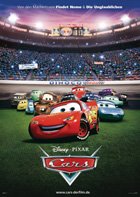
 USA 2006
USA 2006





